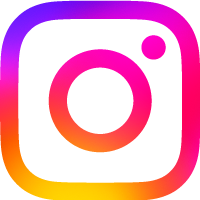Der Hochschulsektor expandiert. Dennoch bestimmt zunehmend prekäre und instabile Beschäftigung das Bild an den staatlichen Universitäten und Hochschulen.
Im Zuge der Hochschulexpansion sind im vergangenen Jahrzehnt durch die langfristige Umsteuerung in der Finanzierung viele befristete Arbeitsverhältnisse entstanden. An den Fachhochschulen wird inzwischen ein großer Teil der Lehre über gering honorierte Lehraufträge abgedeckt.
Anstatt die stark gestiegenen Studierendenzahlen mit einer entsprechenden Zunahme öffentlicher Mittel für die Lehre zu kompensieren, fließen öffentliche Gelder in großem Umfang in Forschungswettbewerbe, etwa die Exzellenzinitiative. Das Resultat sind eine enorme Zahl an befristeten Stellen im wissenschaftlichen Mittelbau an Universitäten. Außerdem ermöglicht das Wissenschaftszeitvertragsgesetz prinzipiell endlose Kettenbefristungen für drittmittelfinanzierte Stellen. Die Befristungsquote im wissenschaftlichem Mittelbau an deutschen Universitäten liegt daher bei über 80 Prozent. Die Chancen, eine der begehrten Professuren zu ergattern, sind folglich sehr gering.
Wegen einer niedrigen Grundausstattung seitens des Landes ist die Universität Bremen besonders auf Drittmittel angewiesen. Die Exzellenzinitiative, von der die Universität profitiert, hat zwei Seiten: Die Forschungslandschaft hierzulande wird bereichert, die zahlreichen, befristet in Drittmittelprojekten Beschäftigten jedoch, haben wenig nachhaltige Perspektiven.
Auch die finanzielle Grundausstattung der Fachhochschulen im Land Bremen wird dem enormen Anstieg der Studierendenzahlen längst nicht mehr gerecht. Die Hochschulen Bremen und Bremerhaven haben im Laufe ihrer Expansion immer mehr Lehraufträge vergeben, die die Lehre nach dem Bremischen Hochschulgesetz eigentlich nur ergänzen sollen. Lehrbeauftragte arbeiten zu Honoraren, die eher eine Aufwandsentschädigung als ein Einkommen darstellen. Sie sind wesentlich kostengünstiger und belasten die Hochschuletats weitaus weniger als sozialversicherungspflichtig beschäftigtes Lehrpersonal. Haben Lehrbeauftragte außerhalb der Hochschule keine existenzsichernde Arbeit, sind sie langfristig in einer Situation prekärer Selbstständigkeit. Außerdem stehen Lehrbeauftragte als externe Kräfte nicht im gleichen Umfang für die Betreuung der Studierenden zur Verfügung wie fest angestellte Lehrende. Dass darunter die Lehrqualität leidet, hat auch der Wissenschaftsrat in seinen Empfehlungen zur Weiterentwicklung des Hochschulsystems des Landes Bremen (2013, S. 130) festgehalten.
Der im November 2016 unterzeichnete Rahmenkodex "Vertragssituationen und Rahmenbedingungen von Beschäftigungen an den staatlichen Bremischen Hochschulen" wurde in einer gemeinsamen Arbeitsgruppe von Gewerkschaften, Personalräten, Arbeitnehmerkammer, dem Kollegiumsrat der akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Universität Bremen und den Frauenbeauftragten mit der Senatorin für Wissenschaft und den Leitungen der Hochschulen verhandelt. Er ist eine Selbstverpflichtung der Hochschulen für eine bessere Ausgestaltung der Beschäftigungsverhältnisse. Er soll größere Transparenz und Planbarkeit, insbesondere bei befristetet Beschäftigten, schaffen. Um jedoch langfristig gute Beschäftigungsbedingungen sicherstellen zu können, braucht es eine solide und verlässliche Grundfinanzierung der Hochschulen sowie eine Verankerung der Grundlagen aus dem Rahmenkodex in hochschulinternen Verfahren.
- Gewerkschaften und Arbeitnehmerkammer fordern unbefristete Stellen für Daueraufgaben in Forschung und Lehre. Nehmen Lehrbeauftragte langfristig Lehr- und Prüfungsaufgaben wahr, müssen sie sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse erhalten.
- Familiengerechte Hochschulen mit stabilen Arbeitsverhältnissen erhöhen den Frauenanteil an Universitäten und Hochschulen - auch bei den Professuren - eher als grundsätzlich wünschenswerte Quotenregelungen und einzelne Frauenförderprogramme.
- Für die wissenschaftlich Beschäftigten müssen wieder mehr Mitbestimmungsmöglichkeiten in den Hochschulgremien geschaffen werden.
- Die transparente Ausgestaltung befristeter Qualifikations- und Drittmittelstellen müssen so umgesetzt werden, wie sie in den die Regelungen des Rahmenkodex von Gewerkschaften, Arbeitnehmerkammer und Personalräte mit den Hochschulen und der Senatorin für Wissenschaft verhandelt wurde.
- Wissenschaft in Bremerhaven
- Offene Hochschulen
- Berufliche Weiterbildung
Schlagwörter
Downloads
Beschäftigungsbedingungen an Hochschulen im Land Bremen
Erschienen in: Bericht zur Lage der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Land Bremen 2017
Download PDFWissen macht schön!
Strukturwandel, Imagewechsel und die Bedeutung des Wissenschaftssektors in Bremerhaven
Download PDF
März 2016Bildung ist Menschenrecht
Position des DGB zu einem Wissenschaftsplan 2020 im Land Bremen
Download PDF
April 2014
Kontakt

Jessica Heibült
Referentin für Bildungs- und Hochschulpolitik
Am Wall 195
28195 Bremen
Tel.: 0421/36301-975
Fax: 0421/36301-995
- Rahmenkodex "Vertragssituationen und Rahmenbedingungen von Beschäftigungen an den staatlichen Bremischen Hochschulen"
- GEW: Bewertung der Reform des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes
- Wissenschaftliches und künstlerisches Personal nach Beschäftigungsverhältnis und Personalgruppe an den Hochschulen des Landes Bremen
- Perspektiven des wissenschaftlichen Nachwuchses: Öffentlichen Anhörung am 12.06.2013 im Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung des Deutschen Bundestages