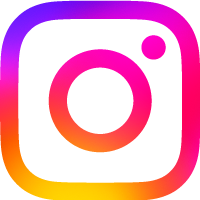Das Mutterschutzgesetz möchte die Chancen der Frauen verbessern und ihre Rechte stärken. Durch das Gesetz wird Schwangeren und stillenden Frauen ein Gesundheitsschutz zugesichert.
Stand: 7. März 2024
Damit sie ihre und die Gesundheit des Kindes nicht gefährden, in ihrem Berufsleben nicht benachteiligt oder in ihren Entscheidungen über eine Erwerbstätigkeit beeinträchtigt werden. Die wichtigsten Informationen im Überblick:
1. Wer profitiert vom Mutterschutz?
2. Wann muss ich den Arbeitgeber informieren?
3. Wann beginnt der Mutterschutz und wie lange dauert er?
4. Wie werde ich während der Mutterschutzfristen bezahlt
und wie wirkt sich Kurzarbeit aus?
5. Welche Unterlagen benötige ich für die Krankenkasse?
6. Welche Leistungen übernehmen die Krankenkassen noch?
7. Was ist, wenn ich während der Schwangerschaft nicht mehr
oder nur noch eingeschränkt arbeiten kann?
8. Wie werde ich während meines Beschäftigungsverbots bezahlt?
9. Kann ich während und nach meiner Schwangerschaft gekündigt werden?
10. Habe ich Anspruch auf Freistellung für Untersuchungen?
1. Wer profitiert vom Mutterschutz?
Das Mutterschutzgesetz gilt für alle (werdenden) Mütter, die in Deutschland in einem Arbeitsverhältnis stehen, ohne Rücksicht auf die Staatsangehörigkeit der Arbeitnehmerin oder des Arbeitgebers.
Dazu gehören auch Heimarbeiterinnen, Hausangestellte, geringfügig Beschäftigte, Auszubildende, Volontärinnen, Praktikantinnen und zur beruflichen Weiterbildung nach dem SGB III Beschäftigte.
Zusätzlich gilt das Mutterschutzgesetz auch für Schülerinnen und Studentinnen, Frauen im Freiwilligendienst, arbeitnehmerähnlich beschäftigte Frauen, Entwicklungshelferinnen und behinderte Frauen mit einer Tätigkeit in einer Behindertenwerkstatt erfasst. Das Mutterschutzgesetz gilt nicht für Beamtinnen, Richterinnen und Soldatinnen, denn für sie gelten Sonderregelungen.
2. Wann muss ich den Arbeitgeber informieren?
Sobald Frauen von ihrer Schwangerschaft wissen und den voraussichtlichen Entbindungstermin kennen, sollten sie dem Arbeitgeber dies mitteilen. Dabei handelt es sich nicht um eine erzwingbare Rechtspflicht, sondern um eine Empfehlung im eigenen (gesundheitlichen) Interesse und im Interesse des ungeborenen Kindes, da der Arbeitgeber nur so die Mutterschutzbestimmungen einhalten kann.
Fragt der Arbeitgeber vor einer Einstellung die Frau nach einer eventuell bestehenden Schwangerschaft, so hat sie ein „Recht zur Lüge“, das heißt, sie muss diese Frage nicht beantworten. Der Grund: Es handelt sich dabei um eine unmittelbare Diskriminierung wegen des Geschlechts, die gegen das Benachteiligungsverbot verstößt und somit verboten ist.
3. Wann beginnt der Mutterschutz und wie lange dauert er?
Sechs Wochen vor der Entbindung dürfen werdende Mütter nicht arbeiten (Mutterschutzfrist vor der Geburt). Der Beginn des Zeitraums ergibt sich aus dem voraussichtlichen Geburtstermin, den der Arzt oder die Ärztin errechnet hat. Nach der Geburt schließt sich eine weitere Mutterschutzfrist von acht Wochen an.
Bei Früh- und Mehrlingsgeburten verlängert sich die Frist nach der Geburt auf zwölf Wochen. Auf Antrag der Frau verlängert sich die Mutterschutzfrist auch dann auf zwölf Wochen nach der Geburt, wenn bei dem Kind eine Behinderung festgestellt wird.
Kommt das Kind vor dem errechneten Geburtstermin auf die Welt, verlängert sich die Mutterschutzfrist nach der Geburt zusätzlich um die Tage, die die Frau von der Mutterschutzfrist vor der Entbindung nicht in Anspruch genommen werden konnten.
Die Schutzfristen stehen nur leiblichen Müttern zu und gelten daher nicht für berufstätige Adoptiv- oder Vollzeitpflegemütter. Es besteht aber Anspruch auf Elternzeit ab Aufnahme des Kindes.
4. Wie werde ich während der Mutterschutzfristen bezahlt?
Während der Mutterschutzfristen erhalten Arbeitnehmerinnen von ihrer Krankenkasse, bei der sie gesetzlich versichert sind, Mutterschaftsgeld und einen Arbeitgeberzuschuss zum Ausgleich ihres Nettoverdienstes.
Das Mutterschaftsgeld der Krankenkasse berechnet sich aus dem durchschnittlichen kalendertäglichen Arbeitsentgelt der letzten drei abgerechneten Kalendermonate (der Monat wird mit 30 Kalendertagen gerechnet) vor Beginn der sechswöchigen Schutzfrist. Dabei zahlt die Krankenkasse jedoch höchstens 13 Euro pro Kalendertag (monatlich höchstens 364 Euro beziehungsweise 403 Euro, je nach Länge des Monats).
Arbeitgeber stockt auf
Für alle Frauen, deren kalendertägliches Nettogehalt 13 Euro übersteigt, reicht das Mutterschaftsgeld nicht aus, um während der Schutzfristen und am Entbindungstag das volle Nettoeinkommen zu sichern. Deshalb ersetzt ihnen ihr Arbeitgeber den Unterschiedsbetrag zwischen dem kalendertäglichen Mutterschaftsgeld von 13 Euro und ihrem tatsächlichen Nettoarbeitsgeld. Beträgt dies beispielsweise 25 Euro steuert der Arbeitgeber zwölf Euro pro Tag zum Einkommen der Frau bei.
Verlängert sich die sechswöchige Schutzfrist vor der Entbindung, da das Kind später als errechnet auf die Welt kommt, wird für die gesamte Zeit Mutterschaftsgeld und Arbeitgeberzuschuss gezahlt.
Für Frauen, die nicht gesetzlich krankenversichert sind oder geringfügig beschäftigt sind (Minijob), kann ein einmaliges Mutterschaftsgeld in Höhe von 210 Euro vom Bundesamt für soziale Sicherung beantragt werden.
5. Welche Unterlagen benötige ich für die Krankenkasse?
Den Antrag auf Mutterschaftsgeld sollten Arbeitnehmerinnen möglichst vor Beginn der Mutterschutzfrist vor der Geburt einreichen. Eine gesetzlich geregelte Frist gibt es nicht.
Formulare für den Mutterschaftsgeldantrag sind häufig online bei der jeweiligen gesetzlichen Krankenkasse zu finden.
Für den Antrag benötigen werdende Mütter folgende Nachweise:
- Unterschriebener Antrag auf Mutterschaftsgeld
- Ärztliche Bescheinigung über den voraussichtlichen Entbindungstermin
- Verdienstbescheinigung des Arbeitgebers
- Geburtsbescheinigung vom Standesamt, wenn das
- Kind schon geboren ist
- Bei Frühgeburten: ärztliche Bescheinigung
Der Antrag auf ein einmaliges Mutterschaftsgeld in Höhge von 210 Euro für nicht gesetzlich krankenversicherte oder in einem Minijob tätige Frauen wird gestellt beim Bundesamt für soziale Sicherung, Friedrich-Ebert-Alee 28, 53113 Bonn.
6. Welche Leistungen übernehmen die Krankenkassen noch?
Alle werdenden Mütter, die Mitglied der gesetzlichen Krankenkasse oder familienversichert sind, haben Anspruch auf
- Vorsorgeuntersuchungen
- ärztliche Betreuung und Hebammenhilfe
- Versorgung mit Arznei-, Verband- und Heilmitteln
- eine stationäre Entbindung
- häusliche Pflege
- Haushaltshilfe
Diese Leistungen gelten auch für arbeitslose Frauen und Empfängerinnen von Arbeitslosengeld II. Sozialhilfeempfängerinnen erhalten vergleichbare Leistungen. Für privat krankenversicherte Frauen ergibt sich der Anspruch aus den Versicherungsbedingungen der privaten Krankenversicherung.
7. Was ist, wenn ich während der Schwangerschaft nicht mehr oder nur noch eingeschränkt arbeiten kann?
Das Mutterschutzgesetz regelt Beschäftigungsverbote, die dem Gesundheitsschutz der schwangeren Frau und ihres ungeborenen Kindes dienen. Viele Regelungen gelten auch für stillende Frauen. Dazu gehört unter anderem das Verbot der Mehrarbeit, das Nachtarbeitsverbot und das Verbot der Sonn- und Feiertagsarbeit.
Mehrarbeit:
Eine volljährige Frau darf nicht mehr als achteinhalb Stunden täglich (90 Stunden innerhalb von zwei Wochen) beschäftigt werden. Ist die Frau unter 18 Jahre alt, so darf sie täglich nur acht Stunden (80 Stunden innerhalb von zwei Wochen) arbeiten. Eine schwangere oder stillende Frau darf nicht über ihre arbeitsvertraglich vereinbarte Arbeitszeit hinaus beschäftigt werden, das heißt Überstunden sind ausgeschlossen. Dies kommt vor allen Dingen teilzeitbeschäftigten Frauen zugute.
Nachtarbeit:
Eine schwangere oder stillende Frau darf nicht in der Zeit zwischen 20.00 Uhr und 6.00 Uhr beschäftigt werden. Zwischen 20.00 Uhr und 22.00 Uhr darf die Frau nur dann arbeiten, wenn der Arbeitgeber beim Gewerbeaufsichtsamt eine Genehmigung beantragt hat, die Frau mit der Weiterarbeit nach 20.00 Uhr einverstanden ist und eine ärztliche Unbedenklichkeitsbescheinigung vorliegt. Außerdem darf keine unverantwortbare Gefährdung durch Alleinarbeit mit der Arbeit bis 22.00 Uhr verbunden sein.
Solange das Gewerbeaufsichtsamt die Weiterarbeit nicht vorläufig verbietet, darf die Frau weiterbeschäftigt werden. Hat das Gewerbeaufsichtsamt nicht innerhalb von sechs Wochen reagiert, gilt außerdem die Genehmigung zur Arbeit zwischen 20.00 Uhr und 22.00 Uhr als erteilt. Nach 22.00 Uhr darf die Frau nur in besonders begründeten Einzelfällen arbeiten.
Das Gewerbeaufsichtsamt muss dies aber vorher genehmigen. Ihr Einverständnis zur Weiterarbeit kann die Frau jederzeit widerrufen.
Sonn und Feiertagsarbeit:
Auch an Sonn- und Feiertagen darf eine schwangere und stillende Frau nicht beschäftigt werden. Allerdings gibt es Ausnahmen. Deshalb kann zum Beispiel in Krankenhäusern, Gaststätten, in Not- und Rettungsdiensten, im Fremdenverkehr, in Verkehrsbetrieben, beim Rundfunk, auf Messen, Ausstellungen, Märkten und in Theatern und so weiter ausnahmsweise auch an Sonn- und Feiertagen gearbeitet werden.
Voraussetzung ist aber, dass sich die schwangere oder stillende Frau damit einverstanden erklärt hat, im Anschluss an die Sonn- oder Feiertagsarbeit eine Ruhezeit von mindestens elf Stunden eingehalten wird und die Frau einen Ersatzruhetag in Anspruch nehmen kann.
Wie beim Nachtarbeitsverbot darf sich keine unverantwortbare Gefährdung durch Alleinarbeit an Sonn- und Feiertagen ergeben. Auch kann die Frau ihr Einverständnis jederzeit widerrufen.
Betrieblicher Gesundheitsschutz
Der Arbeitgeber muss eine Gefährdungsbeurteilung durchführen und feststellen, ob die schwangere oder stillende Frau und ihr Kind durch die Tätigkeit bestimmten Gefährdungen ausgesetzt sind, die Schutzmaßnahmen oder eine Umgestaltung der Arbeitsbedingungen erforderlich machen. Muss der Arbeitgeber danach Schutzmaßnahmen ergreifen, so muss er zunächst prüfen, ob mit der Umgestaltung der Arbeitsbedingungen ein ausreichender Gesundheitsschutz sichergestellt werden kann. Wenn dies nicht der Fall ist, ist er verpflichtet, einen Arbeitsplatzwechsel (Umsetzung, Versetzung) in Betracht zu ziehen. Wenn auch der Arbeitsplatzwechsel im Betrieb nicht möglich ist, kommt es zu einem Beschäftigungsverbot des Arbeitgebers, das heißt, die Frau darf nicht mehr weiterarbeiten.
Ausdrücklich verboten sind unabhängig von der Gefährdungsbeurteilung Tätigkeiten, bei denen die Frau zum Beispiel keimzellschädigenden, krebserregenden und giftigen Stoffen, bestimmten Biostoffen, dem Rötelnvirus, Toxoplasma, Strahlungen, Erschütterungen, Vibrationen, Lärm, Hitze, Kälte und Nässe ausgesetzt ist. Darüber hinaus darf eine schwangere Frau nicht mit Akkord- und Fließarbeit sowie getakteter Arbeit beschäftigt werden. Auch untersagt sind Arbeiten, bei denen sie ohne mechanische Hilfsmittel regelmäßig mehr als fünf Kilo oder gelegentlich mehr als zehn Kilo heben oder nach Ablauf des fünften Schwangerschaftsmonats mehr als vier Stunden überwiegend bewegungsarm stehen muss.
Für stillende Mütter gelten zum Teil ähnliche Verbote, insbesondere ist aber der Kontakt mit bestimmten Biostoffen nach der Biostoffverordnung und mit Blei und Bleiderivaten verboten.
Liegt eine der verbotenen Tätigkeiten vor, so muss der Arbeitgeber zwingend ein Beschäftigungsverbot aussprechen.
Ärztlicher Gesundheitsschutz
Auch der Ärztin oder der Arzt können ein Beschäftigungsverbot aussprechen, wenn die schwangere Frau oder ihr Kind durch die Weiterbeschäftigung gesundheitlich, das heißt körperlich oder psychisch, gefährdet ist. Es handelt sich um ein individuelles Beschäftigungsverbot, das durch ein ärztliches Attest bescheinigt wird.
8. Wie werde ich während meines Beschäftigungsverbots bezahlt?
Für die Zeit des Beschäftigungsverbots erhalten betroffene Frauen Mutterschutzlohn vom Arbeitgeber. Dies ist vom Mutterschaftsgeld während der Schutzfristen vor und nach der Geburt des Kindes zu unterscheiden. Der Mutterschutzlohn richtet sich nach ihrem Durchschnittsverdienst der vergangenen drei Monate vor Eintritt der Schwangerschaft, sodass in der Regel der volle Verdienst sichergestellt ist.
Beginnt das Arbeitsverhältnis erst nach Eintritt der Schwangerschaft, muss das durchschnittliche Gehalt aus den ersten drei Monaten der Beschäftigung berechnet werden. Ändert sich die Höhe des Gehalts dauerhaft, also zum Beispiel bei einer Arbeitszeitverkürzung oder Arbeitszeiterhöhung, muss der geänderte Verdienst dem Mutterschutzlohn zugrunde gelegt werden, wenn die Änderung im Berechnungszeitraum eingetreten ist. Ist die Änderung danach eingetreten, wird der höhere oder niedrigere Verdienst ab dem Zeitpunkt der Änderung wirksam.
Einmalzahlungen, wie zum Beispiel ein Weihnachts- oder Urlaubsgeld, fließen nicht in die Berechnung des Mutterschutzlohnes ein.
9. Kann ich während und nach meiner Schwangerschaft gekündigt werden?
Nein, das Mutterschutzgesetz schützt umfassend davor. Dieser Schutz beginnt mit der Schwangerschaft und gilt bis vier Monate nach der Entbindung. Das Kündigungsverbot gilt auch während der Elternzeit – dann sowohl für Mütter als auch für Väter.
Das Kündigungsverbot umfasst nicht nur jede fristgerechte Kündigung, sondern auch eine fristlose Kündigung aus wichtigem Grund sowie eine Kündigung in der Probezeit. Ferner sind Kündigungen vor der vereinbarten Tätigkeitsaufnahme umfasst. Auch bei einer Fehlgeburt nach der zwölften Schwangerschaftswoche gilt ein Kündigungsverbot von vier Monaten.
Lässt eine Frau einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen, so endet zu diesem Zeitpunkt der Kündigungsschutz. Der Kündigungsschutz bleibt jedoch erhalten, wenn ein Kind tot geboren wird, später stirbt oder wenn die Mutter es zur Adoption freigibt.
Genehmigung zur Kündigung wird nur selten erteilt
Voraussetzung für das Eintreten des Kündigungsschutzes ist, dass der Arbeitgeber bei Ausspruch der Kündigung von der Schwangerschaft beziehungsweise der Entbindung weiß. Das Kündigungsverbot gilt trotzdem, wenn die Mitarbeiterin den Arbeitgeber innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der (schriftlichen) Kündigung über ihre Schwangerschaft oder Entbindung informiert.
Will er trotz Kenntnis von der Schwangerschaft kündigen, so muss er vor Ausspruch der Kündigung eine Genehmigung beim Gewerbeaufsichtsamt einholen. Die Genehmigung zur Kündigung wird allerdings nur in absoluten Ausnahmefällen erteilt, zum Beispiel bei Insolvenz des Arbeitgebers.
Wer trotz Schwangerschaft eine Kündigung erhält, sollte innerhalb von drei Wochen ab Zugang der Kündigung Klage beim Arbeitsgericht einreichen, um die Wirksamkeit der Kündigung überprüfen zu lassen.
10. Habe ich Anspruch auf Freistellung für Untersuchungen?
Ja, wenn werdende Mütter den Arzt oder eine Hebamme, zum Beispiel für Vorsorgeuntersuchungen, aufsuchen möchten und der Termin in die Arbeitszeit fällt. Sie müssen zwar Rücksicht auf die betrieblichen Belange des Arbeitgebers nehmen und den Termin möglichst außerhalb der Arbeitszeit legen, ist dies aber nicht möglich, so muss der Arbeitgeber sie unter Fortzahlung des Gehaltes freistellen. Die Arbeitnehmerin ist nicht verpflichtet, diese Zeiten vor- oder nachzuarbeiten.
11. Was passiert mit meinem Anspruch auf Urlaub?
Erholungsurlaub darf wegen eines Beschäftigungsverbotes oder aufgrund der Mutterschutzfristen nicht gekürzt werden. Der Anspruch auf bezahlten Erholungsurlaub ist nämlich nicht an die tatsächliche Arbeitsleistung, sondern an das bestehende Arbeitsverhältnis geknüpft. Wenn die Arbeitnehmerin ihren Urlaub vor Beginn der Beschäftigungsverbote/Mutterschutzfristen nicht oder nicht vollständig erhalten hat, kann sie nach Ablauf der Schutzfristen den Resturlaub im dann laufenden oder im nächsten Urlaubsjahr beanspruchen.
Schließt sich an den Mutterschutz eine Elternzeit an, kann der Urlaub auch noch nach deren Ende genommen werden.
12. Erneute Schwangerschaft in einer laufenden Elternzeit
Wird eine Arbeitnehmerin während einer laufenden Elternzeit erneut schwanger, kann sie die Elternzeit ohne Zustimmung ihres Arbeitgebers vorzeitig beenden, um die Mutterschutzfristen vor und nach der Geburt des Weiteren Kindes in Anspruch zu nehmen.
Dies ist finanziell attraktiv, da sie das Mutterschaftsgeld und den Arbeitgeberzuschuss in der Höhe ihres Verdienstes vor der Geburt des ersten Kindes erhält.
Beendet sie die laufende Elternzeit dagegen nicht, erhält sie Mutterschaftsgeld und Arbeitgeberzuschuss nur in Höhe des Verdienstes aus einer möglichen Teilzeitarbeit während der Elternzeit, ansonsten nur das Mutterschaftsgeld von der Krankenkasse.
Bei Unklarheiten und Fragen können sich sowohl der Arbeitgeber als auch die Arbeitnehmerin an das örtlich zuständige Gewerbeaufsichtsamt wenden. Hat die Frau Schwierigkeiten mit dem Arbeitgeber, sollte sie unbedingt auch den Betriebsrat/Personalrat und die Frauen- oder Gleichstellungsbeauftragte (falls vorhanden) informieren und um Hilfe bitten.
Aktivierung erforderlich!
Mit einem Klick auf dieses Vorschaubild willigen Sie ein, dass Inhalte von Google (USA) nachgeladen werden. Hierdurch erhält Google (USA) die Information, dass Sie unsere Seite aufgerufen haben sowie die in diesem Rahmen technisch erforderlichen Daten. Wir haben auf die weitere Datenverarbeitung durch Google keinen Einfluss. Bitte beachten Sie, dass in Bezug auf Google (USA) kein angemessenes Datenschutzniveau vorliegt.
Unsere Informationen zum DatenschutzZum VideoAnfragen online
Hier können Sie uns als Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer im Land Bremen rechtliche Fragen zum Arbeits- und Sozialversicherungsrecht stellen.
Nutzen Sie bitte dieses Formular, wenn Sie allgemeine Fragen haben (dort keine Rechtsfragen stellen).
Schlagwörter
Rechtsberatung
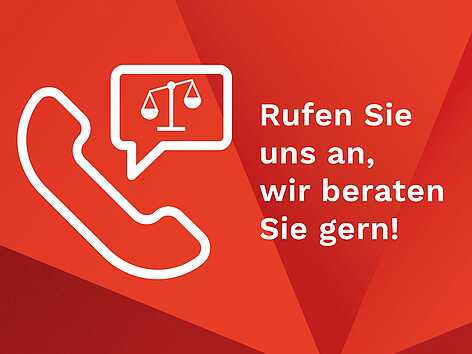
Sie haben rechtliche Fragen?
Unsere Telefonberatung
Bremen: 0421-36301-11
Bremerhaven: 0471-92235-11
Mo., Di., Mi. und Do.: 9 - 16 Uhr,
Fr.: 9 - 12 Uhr

- Rund um das Thema Mutterschutz
familiennetz bremen
Das familiennetz bremen ist eine kostenlose Servicestelle, die Fragen rund um das Thema Familie beantwortet. Auf der Webseite gibt es einen Überblick über wohnortnahe Angebote von über 800 Einrichtungen in Bremen sowie vielfältige Informationen für Familien und Fachkräfte. Hier geht es zur Webseite.
Anfragen Online
Hier können Sie uns als Mitglied rechtliche Fragen stellen (nur zum Arbeits- und Sozialversicherungsrecht).
Nutzen Sie bitte dieses Formular, wenn Sie allgemeine Fragen haben (bitte hier keine Rechtsfragen stellen).
Ihre Meinung ist uns wichtig!
Hier können Sie uns Anregungen, Lob und Kritik mitteilen.
Infoblätter

Infoblatt Mutterschutz
pdf-Datei zum Herunterladen
Infoblatt Elterngeld
pdf-Datei zum Herunterladen
Infoblatt Elternzeit
pdf-Datei zum Herunterladen
Broschüre

"Mutterschutz, Elterngeld, Elternzeit"
Ein Ratgeber der Arbeitnehmerkammer Bremen, April 2018
Autorin: Dr. Bettina Graue
Download pdf (186 Seiten)
Infotool Familienleistungen
Mit dem Infotool des Bundesfamilienministeriums können Sie in wenigen Schritten ermitteln, auf welche Familienleistungen und Hilfen Sie oder Ihre Familie zum aktuellen Zeitpunkt voraussichtlich Anspruch haben.